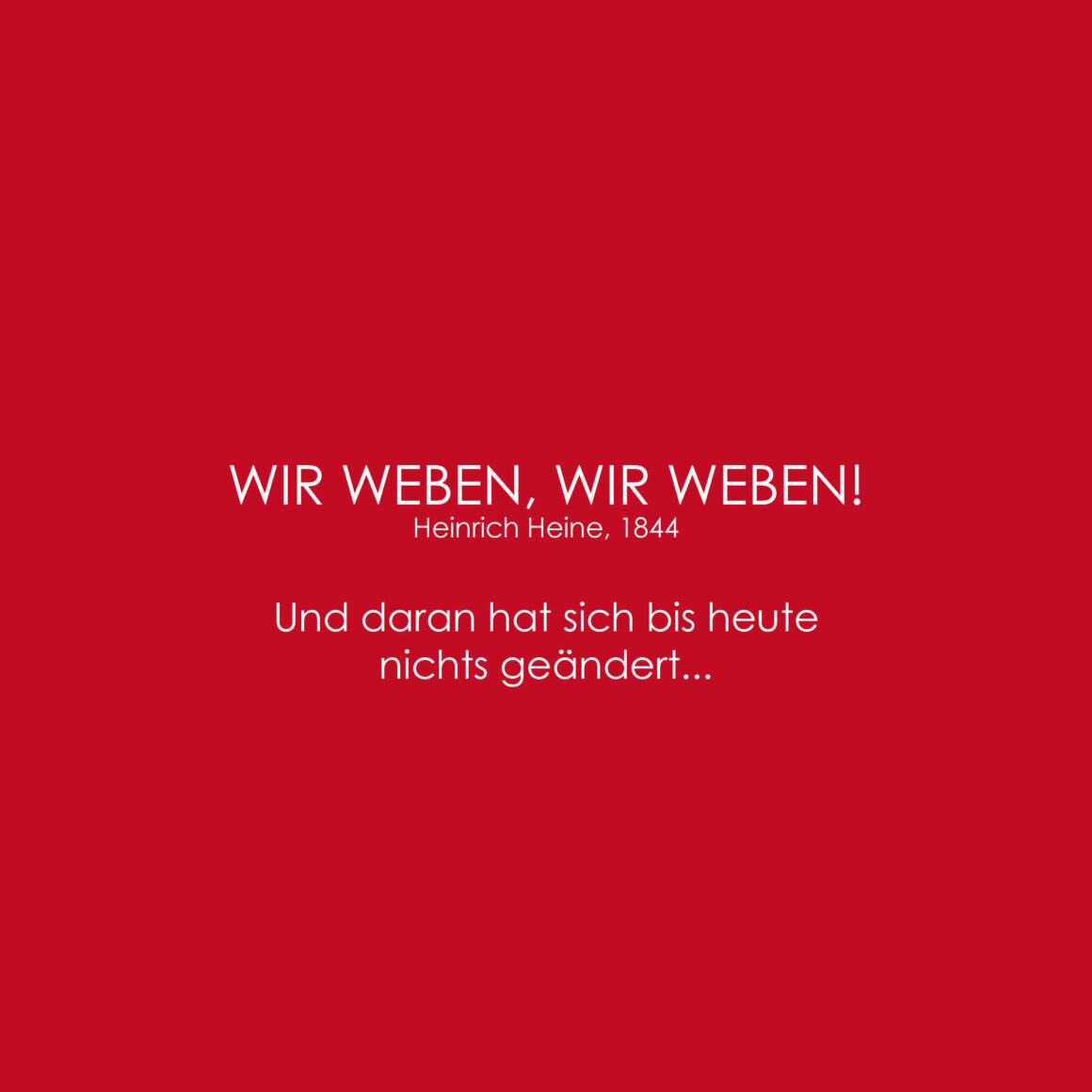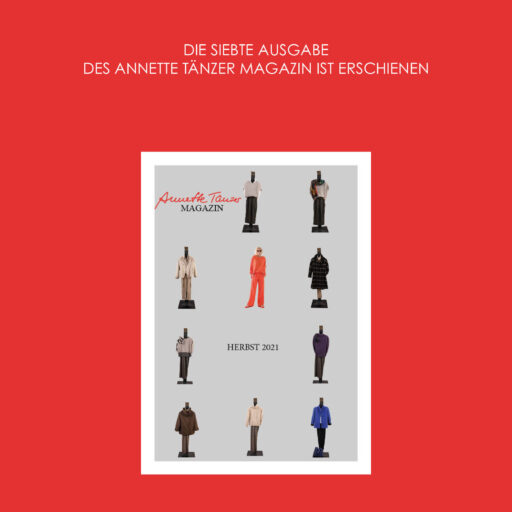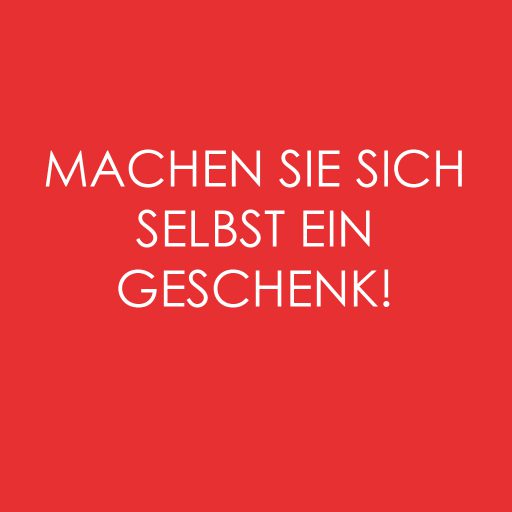In der Montagsausgabe der Neue Zürcher Zeitung lasen wir einen Bericht des Journalisten Matthias Kamp, der über Kleiderfabriken im chinesischen Guangzhou berichtet, wo unter widrigsten Arbeitsbedingungen Textilien für international tätige Billig-Labels hergestellt werden.
Kamp ist es gelungen, persönliche Interviews mit Beschäftigten zu führen und berichtet über Lebens- und Arbeitsbedingungen der dort arbeitenden Menschen, die mit ihrer Gesundheit den Preis dafür bezahlen, daß wir in Europa zum Beispiel eine Jeans für nicht einmal 15 Euro kaufen können.
Berichte über beinahe unvorstellbare Zustände in asiatischen Textilfertigungen sind uns seit Jahren bekannt; Kinderarbeit kommt einem dabei zuerst in den Sinn. Fehlende Sicherheitsstandards, insbesondere im Umgang mit Chemikalien, schlechte Bezahlung und vieles mehr sind der brutale Preis für billiges Shopping bei vollem Rückgaberecht.
In diesem Bericht kommen aber Menschen ganz persönlich zu Wort, die ihre Lebenssituation so nüchtern beschreiben, daß es für uns schon phlegmatisch anmutet.
Ein Arbeitstag dauert in den Nähereien von 8 Uhr bis 22 Uhr, unterbrochen nur von zwei kurzen Pausen, das Ganze an 29 Tagen im Monat, wobei das Durchschnittsgehalt weit unter 1000 Euro liegt, was für ortsübliche Verhältnisse als gar nicht schlecht angesehen wird.
Obwohl die chinesische Regierung immer wieder darauf hinweist, die monatliche Höchstarbeitszeit auf 160 Stunden begrenzt zu haben, wird dies vor Ort von den Behörden keinesfalls kontrolliert, so daß die Arbeiter oft 320 Stunden schuften müssen, um so viel Geld zu verdienen, daß ihre Familien davon leben können.
Jean-Paul Sartre hat in Huis Clos von einem cercle vicieux, einem Teufelskreis, geschrieben, und in eben diesem leben diese Menschen, die für uns solche Billigprodukte herstellen. Gelänge es irgendeiner NGO, diese Ausbeutung durch Fabrikschließungen zu beenden, stünden die Arbeiter auf der Straße. Bei einer Arbeitslosenquote von weit über fünf Prozent und einer weit höher geschätzten Dunkelziffer stünden sie vor dem Nichts, weshalb wohl viele letztlich noch froh sind, auch selbst unter diesen Umständen überhaupt arbeiten zu „dürfen“.
Daß die Unternehmen für ihre Arbeiter auch keine Sozialabgaben abführen, überrascht in diesem Zusammenhang dann auch nicht mehr. Und daran hat auch keine feministische Außenpolitik bisher etwas geändert…